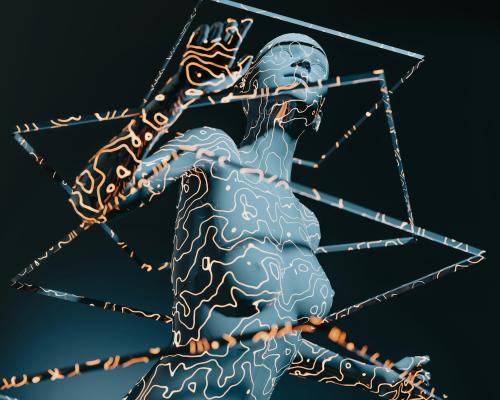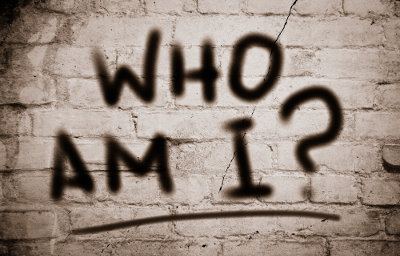Viele Berufstätige – vor allem aus der jüngeren Generation – steigen bewusst aus dem Hamsterrad der Hierarchien aus. Statt Chef:in wollen sie Gestalter:in sein, statt Titel lieber Wirkung. Das Konzept der horizontalen Karriere beschreibt genau diesen Trend: Weiterentwicklung durch neue Rollen, Projekte und Lernfelder – ohne den Zwang zur Führungsverantwortung.
Doch das bedeutet keineswegs, dass horizontale Karrieren weniger ambitioniert sind, sie sind nur anders motiviert. Sie setzen auf fachliche Weiterentwicklung, Vielseitigkeit und Selbstverwirklichung statt auf Status und Hierarchie.
Im Folgenden zeigen wir dir, warum die Zukunft der Arbeit nicht nach oben, sondern nach vorn führt – und wie du deine Karriere anhand konkreter Beispiele und Argumentationshilfen selbstbestimmt auf Breite statt Höhe baust.
Was sind “horizontale” Karrieren?
Eine horizontale Karriere bezeichnet einen Karrierepfad, bei dem nicht primär der Aufstieg in der Hierarchie im Vordergrund steht, sondern seitliche, diagonale oder fachlich neue Bewegungen – also Weiterentwicklung ohne die obligatorische Leitungsposition. Es geht darum, Kompetenzen, Erfahrung und Perspektiven auszubauen, statt nur einen wichtig klingelnden Titel oder eine Rolle mit Status zu erlangen.
Der Begriff ist nicht so populär wie „Karriereleiter“, wird aber im englischen Sprachraum oft in Varianten wie lateral career path, career lattice, lily-pad career oder schlicht horizontal career path verwendet.
Besonders veranschaulicht wird das Konzept durch die Metapher lily-pad career (Deutsch “Seerosen-Karriere”): Sie zeichnet das Gegenbild zur statischen Karriereleiter, bei der man oben ankommen muss. Stattdessen hüpft man von Seerosenblatt zu Seerosenblatt (also von Rolle zu Rolle), sammelt Erfahrungen und bewegt sich innerhalb einer Ebene – statt sich an einer steilen Leiter abzuarbeiten. Die horizontale Richtung steht somit symbolisch für Breite statt Höhe.
Dies ist kein rein theoretisches Konzept, sondern bereits in der Praxis angekommen: Insbesondere größere Unternehmen bieten im Rahmen ihres Personalentwicklungskonzeptes explizit zwei unterschiedliche Laufbahnmodelle an: Eine klassische Führungslaufbahn und einen fachlichen Expert:innen-Pfad (“Fachlaufbahn”), in dessen Verlauf sich Mitarbeitende tiefes Fachwissen aneignen. Dieses Konzept wird auch “Dual Career Ladders” genannt.
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Anti-Ambition – oder Ambition neu gedacht?
Doch warum sind horizontale Karrierepfade aktuell der heiße Scheiß unter den Work-Trends?
Aktuelle Umfragen, darunter von Glassdoor, zeigen, dass 68 % der Generation Z nur dann bereit sind, eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn deutliche Vorteile damit verbunden wären.
Das heißt – entgegen der schon viel zu oft gehörten Klischees – jedoch keineswegs, dass es den jüngeren Fachkräften an Ehrgeiz mangelt, sondern dass sich Werte und Prioritäten verschieben:
- Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit, Flexibilität werden wichtiger. Studien zeigen, dass bei jungen Menschen Autonomie und abwechslungsreiche Aufgaben stärker gewichtet werden als Titel.
- Automatisierung, Digitalisierung, Globalisierung sorgen für Unsicherheit – insofern ist ein Portfolio aus Fähigkeiten und Rollen wertvoller geworden als nur „oben anzukommen”
- Soziale Gerechtigkeit hat bei vielen jungen Menschen einen hohen Stellenwert. Wenn die CEOs im Vergleich zu den Durschschnittsangestellten das 200-fache verdienen, kann dies ein massives Ungerechtigkeitsgefühl auslösen. Absurd hohe Gehälter als Anreiz reichen schlicht nicht mehr aus, wenn die Rahmenbedigungen nicht passen.
- Verschiebung der Verhandlungsposition: Auch lebenserfahrene Generationen hätten sich mit Sicherheit gesunde und faire Arbeitsbedingungen gewünscht, hatten jedoch leider oftmals nicht die Möglichkeit, dies durchzusetzen. Angesichts des Fachkräftemangels in den Führungsetagen haben potenzielle Nachfolgende eine gute Verhandlungsposition. Und diese dürfen und sollen sie natürlich für sich nutzen.
Wenn Karrieren früher oft mit Loyalität und Lebenszeit im Unternehmen gleichgesetzt wurden, gilt heute zunehmend: Agilität zählt. Modelle wie „Jobwechsel alle x Jahre“, „Fachlaufbahnen statt Führungslaufbahnen“, oder eben horizontale Moves sind keine Ausnahme mehr. Unternehmen müssen sich dem anpassen, denn Mitarbeitende wählen zunehmend Wege, die ihnen passen statt dem klassischen Schema.
Vorteile gegenüber der klassischen Karriereleiter
Wenn es nicht Status, Titel oder signifikante Gehaltssteigerungen sind – welche konkreten Vorteile bieten horizontale Karriere-Moves dann?
1. Breiter Kompetenzaufbau
Wer sich “seitlich”, d.h. in neue Fachbereiche oder Rollen hinein entwickelt, stellt sich auf eine breite Basis aus diversen Erfahrungen und Skills aus unterschiedlichen Bereichen. Das macht dich resilienter und flexibler gegenüber Veränderungen und eröffnet dir mehr Möglichkeiten.
Darüber hinaus bietet dir dies Chancen, im Laufe deiner Berufsbiografie unterschiedliche Interessen, Facetten und Stärken auszuleben, statt dich jahrelang mit einem einzigen Thema zu beschäftigen, bis es dir vor lauter Routine und Langeweile zum Hals raushängt. Immer wieder unterschiedliche Fähigkeiten zu stärken, deinen Interessen zu folgen und Neues zu lernen, kann dich langfristig deutlich zufriedener machen.
2. Mehr Entscheidungsspielraum & Sinn
Wenn der Fokus nicht auf „mehr Status“ oder „mehr Verantwortung“ liegt, sondern auf „mehr Wirkung“, kann eine horizontale Rolle genau das liefern, z.B. in Form von Fachverantwortung, temporärer Projektleitung oder einer Spezialist:innenrolle.
In klassischen Führungspositionen spielt zudem oft Machtpolitik eine große Rolle: Abstimmung mit mehreren Hierarchieebenen, politische Machtdynamiken, interne Konkurrenz, taktische Entscheidungen, Statusdenken.
Wer sich innerhalb einer Organisation horizontal bewegt (also z.B. in eine andere Abteilung, Fachrichtung oder ein Projekt mit ähnlicher Hierarchieebene), ist häufig weniger stark in solche internen Machtspiele und formale Strukturen eingebunden. Das kann oft bedeuten: Weniger politische Fallstricke, weniger interne Bürokratie, mehr fachliche oder kreative Gestaltungsfreiheit.
3. Weniger Risiko von Überforderung
Eine klassische Beförderung bringt oft höhere Anforderungen und mehr Verantwortung – oftmals mangelt es jedoch an Ressourcen (z.B. Weiterbildung, Mentoring, Feedback, Freiräume), um dieser Rolle gerecht werden zu können.
Insbesondere junge Führungskräfte finden sich in einer Situation wieder, die hohe Anforderungen (z. B. Arbeitsdruck, Verantwortung, Zeitstress) an sie stellt, ihnen aber gleichzeitig zu wenig Ressourcen (z.B. Weiterbildung, Mentoring, Feedback, Freiräume) zur Verfügung gestellt werden. Konkret: Etwa zu viel Verantwortung bei zu wenig Entscheidungsspielraum, fehlender Anerkennung und unklaren Strukturen.
Das Ergebnis: Stress, Erschöpfung, Überforderung und im Extremfall Burnout. Dadurch empfinden viele junge Menschen Führungsrollen als unattraktiv oder überfordernd – was erklärt, warum sie sich immer seltener aktiv dafür entscheiden.
4. Höhere Flexibilität
In unsicheren Zeiten (Digitalisierung, Wirtschaftskrisen) ist ein breites Kompetenz-Portfolio Gold wert: Fachwissen vertiefen, in angrenzende Disziplinen wechseln, neue Technologien kennenlernen oder sich neu entfaltende Märkte verstehen. Diese Vielfalt erhöht nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit, sondern auch die persönliche Zufriedenheit. Denn statt „nach oben“ geht es „nach vorn“ – in Richtung Vielfalt, Erfahrung und Kompetenz.
Ein Seitenwechsel in ein Projektteam oder eine Expert:innenrolle kann auch dann eine kluge Alternative sein, wenn Führung nicht zum aktuellen Lebensabschnitt passt (z.B. Familienphase, Pflege, Weiterbildung). So wird es möglich, bewusst auch mal Tempo rauszunehmen – ohne auf die „Karrierebremse“ treten zu müssen.
Auch für Organisationen sind horizontale Karrieren ein strategischer Vorteil: Wenn Mitarbeitende seitwärts wechseln können, lassen sich Talente besser halten, Wissen besser verteilen und Abhängigkeiten vermeiden.
5. Bessere Work-Life-Integration
Nicht zwangsläufig – aber oft – bedeutet eine horizontale Rolle: Weniger Überstunden, weniger strategische Verantwortung, mehr Fokus auf Fachlichkeit statt Führung. Anstelle Führungsverantwortung (inkl. Meetings, Entscheidungsdruck und Konfliktmanagement) steht die inhaltliche Arbeit im Vordergrund: Projekte gestalten, neue Skills entwickeln, Prozesse optimieren. Wer sich auf seine Stärken konzentrieren kann, erlebt weniger Stress, hat Erfolgserlebnisse und kann die Arbeit oft selbstbestimmt timen.

Fünf konkrete Beispiele für horizontale Karrierepfade
Doch wie können horizontale Karrierepfade konkret aussehen? Hier kommen fünf Beispiele in verschiedenen Tätigkeitsbereichen:
Marketing: Eine Marketing-Managerin könnte sich horizontal in Richtung Content-Strategie, Community-Management oder Employer-Branding (auf gleicher Hierarchieebene) weiterentwickeln. Dabei nutzt sie ihre umfangreiche Marketing-Expertise, erlangt jedoch zusätzlich neue Skills, arbeitet mit neuen Zielgruppen und erhält mehr kreativen Freiraum.
IT & Tech: Eine Software-Entwicklerin wechselt zu einer Rolle im UX/UI-Design, DevOps, Data Engineering oder entwickelt sich zur Tech Evangelist. Dadurch erhält sie neue Perspektiven, breitere Tech-Kompetenzen, so dass sie nun wesentlich interdisziplinärer arbeiten kann, statt “nur” zu coden.
HR & Personalentwicklung: Ein HR-Manager kann seine Aufgabenschwerpunkte in verschiedene Schwerpunkte hinein ausbauen, etwa in Richtung Talent-Management (stärkerer Fokus auf Personalentwicklung statt -verwaltung), DEIB (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging), Employer Branding oder People Analytics (datenorientiertes, personalisiertes Personalmanagement mit Fokus auf die Bedürfnisse und Motive der Mitarbeitenden). Auf diesem Wege kann er sich vom “ verwaltenden Allrounder” zum Spezialisten mit messbarer Wirkung entwickeln, ohne zwingend „HR-Lead“ zu werden.
Ingenieurwesen/Produktion: Eine Projektingenieurin kann durch gezielte Wahl ihrer Projekteinsätze zusätzliche Skills und spezialisiertes Know-How erwerben, z.B. in den Bereichen Qualitätssicherung, Innovationsmanagement, Energie- oder Umweltmanagement, ESG-Management oder nachhaltige Lieferketten. Somit eröffnet sie sich ein breites Feld mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten und bleibt auch in dynamischen Zeiten bei Zukunftsthemen stets up-to-date.
Vertrieb: Ein Account Manager (Fokus Kundenbetreuung) kann sich entscheiden, sich strategischer auszurichten, etwa durch eine Entwicklung ins Business Development (stärkerer Fokus auf Kooperationen, Erschließung neuer Branchen und Produktinnovationen) oder in den Bereich Customer Success (Customer Success Manager sind stärker in das Tagesgeschäft der Kund:innen involviert und unterstützen diese bei der Optimierung ihrer Produkt-Nutzung). Auch in den neuen Rollen bleibt die Vertriebskompetenz von zentraler Bedeutung, der Fokus wird jedoch strategischer, was oftmals mit weniger Druck einhergeht, Sales Quotas erfüllen zu müssen.
Wie erschließe ich mir eine horizontale Karriere – auch wenn mein Arbeitgeber das (noch) nicht anbietet?
Keine Sorge: Du musst nicht warten, bis dein Unternehmen mit dem perfekten Personalentwicklungskonzept, welches auch Fachkarrieren einschließt, um die Ecke kommt. Hier ein konkreter Fahrplan:
Schritt 1: Selbstreflexion
- Welche Skills habe ich bereits? Welche möchte ich noch entwickeln?
- Welche Bereiche jenseits meiner Routine-Arbeit interessieren mich besonders? Wo gibt es dort Schnittstellen zu meinen aktuellen Tätigkeitsfeldern?
- Was macht mir Spaß – inhaltlich tief eintauchen, strategisch-ganzheitliche Konzeptionierung, Projektarbeit, innovative Konzepte ausprobieren, Prozesse moderierend begleiten?
- Welche Werte sind mir wichtig – Sinn, Flexibilität, eigenständiges Arbeiten, kreativer Spielraum?
Schritt 2: Rollenmap malen
Wenn der klassische Karriereplan die Leiter ist – mit Sprossen, die man mühsam erklimmt –, dann ist die Rollenmap das Gegenteil: eine Landkarte deiner beruflichen Möglichkeiten, auf der du dich frei bewegst. Keine Einbahnstraße, kein „oben“ oder „unten“ – sondern Wege, Kreuzungen, vielleicht auch mal ein kleiner Umweg zu einem spannenden Seitental.
Eine Rollenmap (oder auch „Skill Map“) ist eine visuelle Übersicht deiner beruflichen Rollen, Fähigkeiten, Interessen und Entwicklungspfade. Sie zeigt nicht nur, was du tust, sondern wer du in verschiedenen beruflichen Kontexten sein kannst. Statt dich auf eine Position zu fixieren („Teamleitung Marketing“), zeichnest du die verschiedenen Rollen, die du einnimmst oder einnehmen möchtest: Strateg:in, Kommunikator:in, Analytiker:in, Netzwerker:in, Gestalter:in, Mentor:in. Das Prinzip: Du denkst in Rollen statt in Titeln.
So funktioniert’s konkret:
- Starte in der Mitte: Zeichne dich selbst in die Mitte deines (analogen oder digitalen) Blattes. Schreib deinen aktuellen Jobtitel dazu, aber halte ihn nicht für in Stein gemeißelt.
- Drumherum gruppierst du deine Rollen: Überlege, welche Rollen nimmst du im Arbeitsalltag bereits ein – bewusst oder unbewusst? Bist du die Person, die im Team Struktur schafft? Derjenige, die Konflikte moderiert? Oder die, die in Datensätzen Muster erkennt? Jede dieser Facetten ist eine Rolle, nicht bloß eine Aufgabe.
- Ergänze gewünschte Rollen: Zeichne in einem anderen Farbton Rollen, in die du gerne hineinwachsen würdest. Vielleicht willst du stärker in Richtung Projektentwicklung, Strategie, UX Research, Nachhaltigkeitsmanagement oder Diversity gehen. Wichtig ist, dass du dich nicht auf Hierarchieebenen, sondern auf Inhalts- und Wirkungsebenen fokussierst.
- Verbinde, was sich ergänzt: Zieh Linien zwischen Rollen, die logisch miteinander verknüpft sind – oder zwischen solchen, die du gerne stärker verbinden würdest. So erkennst du Entwicklungspfade, die nicht nach oben, sondern seitwärts oder diagonal verlaufen.
- Ergänze Lernfelder und Ressourcen: Markiere, wo du noch Skills brauchst oder dich weiterentwickeln willst – etwa durch Trainings, Mentoring oder Projekte. Notiere, welche Ressourcen du brauchst: Zeit, Budget, Unterstützung oder einfach nur Rückendeckung von deiner Führungskraft.
Eine Rollenmap ist ein strategisches Werkzeug. Sie zeigt dir auf einen Blick, wie vielseitig du eigentlich bist und welche Entwicklungsmöglichkeiten du innerhalb deines bestehenden Jobs bereits hast. Viele entdecken dabei, dass sie längst eine horizontale Karriere leben – nur ohne es so zu nennen.

Schritt 3: Angebot machen
Wenn dein:e Vorgesetzte:r dich beim nächsten Jahresgespräch fragt, „wo du dich in den nächsten paar Jahren siehst“, dann ist die Rollenmap deine charmante Antwort auf die altbekannte Frage. Statt zu sagen „in einer Führungsrolle“ oder „in einer Position mit mehr Verantwortung“ kannst du sagen:
„Ich sehe mich als Experte, der seine Wirkung in mehreren Rollen entfaltet – quer durch Teams und Projekte. Hier, ich zeig’s Ihnen mal kurz …“
Das ist mutig, reflektiert und signalisiert: Ich will wachsen – aber nicht zwangsläufig nach oben.
Wichtig: Du hast wesentlich bessere Chancen, wenn du deine Vorstellungen als Win-Win-Vorschlag präsentierst – für dich und deinen Arbeitgeber.
Statt zu sagen: „Ich würde gerne mal etwas anderes ausprobieren.“ kannst du sagen: „Ich sehe, dass wir im Bereich XY noch Potenzial haben – und ich könnte mit meinen Fähigkeiten A, B und C dazu beitragen, dass wir das besser nutzen.“
Das ist der entscheidende Perspektivwechsel: Du zeigst, dass du Verantwortung übernehmen und etwas bewegen willst. Das Ziel: Du präsentierst einen Entwicklungspfad, der gleichzeitig ein Organisationsvorteil ist.
Hier einige weitere Formulierungen, die du als Argumentationshilfe nutzen kannst:
- Begründe die Entscheidung mit deinen Stärken und Werten:
„Ich habe gemerkt, dass ich in der fachlichen Tiefe deutlich wirksamer bin als in der Steuerung von Teams.“ - Betone deine Motivation:
„Ich möchte mich künftig auf Aufgaben konzentrieren, bei denen ich selbst gestalten und umsetzen kann – das entspricht mir mehr als klassische Führungsarbeit.“ - Stelle den Nutzen für das Unternehmen heraus:
„In einer operativen Rolle kann ich meine Expertise gezielter einsetzen und motivierter arbeiten – das ist ein Gewinn für beide Seiten.“
Timing ist alles: Der perfekte Moment für dein horizontales Angebot ist nicht das Jahresgespräch, sondern ein Anlass mit strategischer Bedeutung, z.B. wenn dein Team umstrukturiert wird, ein neues Projekt startet oder du eine Lücke siehst, die sonst niemand füllt. Dann ist die Aufmerksamkeit höher, die Offenheit größer – und dein Vorschlag wirkt wie eine Antwort auf ein aktuelles Problem.
Schritt 4: Entwicklung sicht- und messbar machen
Einer der größten Denkfehler in der klassischen Karriere-Logik lautet: „Nur wer aufsteigt, entwickelt sich.“ Das ist, als würde man sagen: „Nur wer lauter spricht, hat mehr zu sagen.“ Beides stimmt nur sehr bedingt.
In der horizontalen Karriere geht es nicht darum, höher, sondern tiefer und breiter zu wachsen – und das will sichtbar werden. Denn: Was man nicht misst, wird leicht übersehen. Und was übersehen wird, hat in den meisten Organisationen leider eine kurze Halbwertszeit.
Sichtbarkeit ist kein Ego-Thema. Viele Menschen, die horizontale Karrierewege anstreben, setzen ihren Fokus eher auf Leistung statt auf sichtbaren Status. Sie tun viel, bewegen viel, reden aber selten darüber. Das ist sympathisch, aber in Systemen, die auf klassische Karriereindikatoren ausgerichtet sind (Titel, Budgets, Teams), kann das zum Bumerang werden.
Sichtbarkeit bedeutet nicht, ständig mit den eigenen Erfolgen zu prahlen. Es bedeutet, Wirkung zu dokumentieren, damit sie wahrgenommen, bewertet und honoriert werden kann.
Oder, wie es die Karriereberaterin Herminia Ibarra (London Business School) formuliert: „Was nicht erzählt wird, existiert nicht – weder in Köpfen noch in Systemen.“
Die entscheidende Frage lautet also nicht: „Welche Position habe ich?“ sondern: „Welche Wirkung habe ich – und wie kann ich sie belegen?“
Statt klassischer Kennzahlen wie Umsatz oder Teamgröße nutzt du Impact-Indikatoren, z.B.:
- Prozesswirkung: Wie haben sich Abläufe, Schnittstellen oder Workflows verbessert, seit du involviert bist?
Kollaboration: Wie hat sich die Zusammenarbeit zwischen Teams oder Abteilungen verändert? - Innovation: Welche neuen Ideen, Formate oder Tools hast du eingebracht oder mitentwickelt?
- Wissensverbreitung: Wie oft wirst du intern zu bestimmten Themen konsultiert oder als Expert:in angefragt?
- Kulturbeitrag: Wie trägst du zur Teamstimmung, Feedbackkultur oder Lernbereitschaft bei?
Diese Punkte kannst du mit Mini-Indikatoren unterfüttern: Zum Beispiel Anzahl umgesetzter Projekte, Feedback aus internen Umfragen, interne Nennungen oder einfach qualitative Statements deiner Kolleg:innen.
Pro-Tipp: Notiere regelmäßig in einem „Wirkungsjournal“ kleine, aber relevante Fortschritte – Projekte, Feedback, Aha-Momente. Das ist eine belegbare Dokumentation deiner horizontalen Lernkurve.
In der Praxis geht es darum, deine Wirkung in bestehende Kommunikationsstrukturen einzubetten, z.B.:
- Regelmäßige Check-ins: Teile Fortschritte im Rahmen von Jour-fixes oder Projekt-Reviews.
- Interne Newsletter oder Slack-Channels: Berichte über Erfolge oder Learnings – kurz, sachlich, mit Mehrwert.
- Lunch & Learn Sessions: Präsentiere anderen Teams, welche Learnings aus deinem Projekt auch auf andere Bereiche der Organisation übertragbar sind
Hier geht es nicht um Selbstmarketing, sondern um Wissensdiffusion. Wer seine Wirkung sichtbar macht, inspiriert auch andere.
Schritt 5: Plan B bedenken
Doch was, wenn dein Arbeitgeber (noch) nicht so weit ist? Wenn dein Vorschlag für eine Querentwicklung im System versandet, weil die HR an alten Strukturen festhält oder die Führungskraft reflexartig blockiert: „Schöner Vorschlag, aber derzeit leider nicht möglich.“
Dann brauchst du einen Plan B:
- Baue deine Skills außerhalb aus (z.B. Weiterbildungen, Netzwerke, Nebenprojekte) – das macht dich beweglich.
- Gibt es Projekte, Initiativen, Ehrenämter oder Communities innerhalb (oder außerhalb) der Organisation, in denen du genau diese Skills praktisch ausprobieren kannst?
- Starte ein Pilotprojekt: Übernimm Verantwortung für ein Querschnittsthema, etwa interne Kommunikation, Nachhaltigkeit oder Wissensmanagement.
- Arbeite in interdisziplinären Teams: Viele horizontale Pfade entstehen an den Schnittstellen – dort, wo keine:r „offiziell zuständig“ ist.
- Netzwerke gezielt: Such dir Mitstreiter:innen, die Lust auf Neues haben. Gemeinsam lässt sich leichter eine „Bottom-up-Bewegung“ anstoßen.
So sammelst du Belege, dass dein Ansatz funktioniert – auch ohne offizielle Freigabe von oben. Wenn dein Pilotprojekt Erfolge zeigt, wird es schwer, dich weiter zu ignorieren.

Stolpersteine & Nachteile horizontaler Karrierepfade
Natürlich gibt es auch bei horizontalen Karrieren einige Fallstricke, die du kennen solltest:
-
Sichtbarkeit & Anerkennung: Ohne den Gewinn eines status-trächtigen “Führungstitels” kann deine Entwicklung „unter dem Radar“ bleiben. Lösung: Sorge dafür, dass dein Impact sichtbar ist – z.B. durch Projekte, Reports, Stakeholder-Feedback.
-
Karriere-Stagnation: Wer zu oft ohne Ziel oder Wirkung lateral von Rolle zu Rolle hüpft, kann womöglich die Orientierung aus dem Blick verlieren. Jeder Move sollte daher vorab gut reflektiert werden: Welchen Mehrwert bringt der Rollenwechsel - sowohl für dich selbst als auch für deine Organisation?
- Vergütung & Status: Manchmal ist ein lateral Move mit weniger Gehalt oder Status verbunden. Wichtig: Kläre im Vorfeld, inwieweit das kompensiert wird oder ob die Rolle tatsächlich so bewertet wird wie ein “Aufstieg”. Auch finanzielle Aspekte sollten bedacht werden: Welchen Lebensstandard strebst du langfristig an und ist dies mit einer horizontalen Entwicklung, die höchstwahrscheinlich mit weniger Gehaltssteigerung einhergeht als eine klassische Karrierelaufbahn, vereinbar?
- Organisation ist nicht vorbereitet: Wenn dein Arbeitgeber (noch) auf traditionelle Modellen pocht, bekommst du eventuell wenig Unterstützung, z.B. durch Trainings oder entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen. Dann empfiehlt es sich, interne Verbündete zu suchen (HR, Kolleg:innen, Mentor:innen) oder Möglichkeiten bei anderen Arbeitgebern zu prüfen.
Rückkehr zur Führungslaufbahn – geht das?
Kurz und klar: Ja, auch nach einigen horizontalen Moves steht dir der Wechsel in eine Führungsrolle offen. Ein horizontaler Pfad schließt linearen Aufstieg nicht aus. Tatsächlich:
- Deine Breite kann dich besser für Führung machen – du verstehst mehr Funktionen, hast ein größeres Netzwerk.
- Du kannst einen Zeitpunkt wählen, an dem du bereit bist, statt dich zu früh mit einer Führungsrolle zu überfordern.
- Wenn dein Unternehmen ein Modell mit Fach- und Führungslaufbahn hat, kannst du aus der Fachbahn später in die Führungbahn wechseln.
Wichtig: Kommuniziere früh, dass Führung nicht ausgeschlossen ist, sondern nur nicht das primäre Ziel im Jetzt. So bleibst du offen – und kannst später eine fundierte Entscheidung treffen.
Fazit: Selbstgestaltung als Karriereprinzip.
Die alte Karriereformel „Mehr Status, mehr Gehalt, mehr Macht“ verliert zunehmend an Glanz.
Nicht, weil die jungen Generationen faul wären, sondern weil sie verstanden haben, dass der Preis für Führung und Status oft zu hoch ist.
Horizontale Karrieren sind keine Leistungsverweigerung, sondern eine Neuinterpretation von Erfolg. Sie sind die Antwort auf eine Arbeitswelt, die sich nicht mehr an Hierarchien, sondern an Kompetenzen, Neugier und Lebensqualität orientiert. Sie bieten vieles von dem, was die klassische Karriereleiter oft verspricht, aber selten hält: Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Sinn.
Und: Wer sich vielseitig entwickelt, kann später immer noch hoch hinaus – nur auf einer stabileren Basis. Denn wer das Spielfeld kennt, kann das Spiel besser führen.